Konkurrenz belebt (nicht immer) das Geschäft
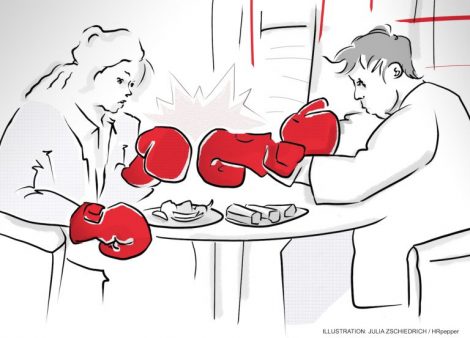
Ob im Sport, in der Politik oder in der Wirtschaft: In vielen Lebensbereichen gelten Konkurrenz und Wettbewerb als belebende Elemente. Man stelle sich vor, die Bundesliga bestünde nur aus einem Verein, im Bundestag säße nur eine Partei und in jedem Wirtschaftssektor gäbe es lediglich ein Unternehmen. Die meisten Bürgerinnen und Bürger dürften sich einig sein, dass ein derartig eingeschränkter Wettbewerb wenig begrüßenswert wäre. Wie aber verhält es sich, wenn wir den Blick auf das Innenleben einzelner Organisationen richten? Was sagt die Forschung zum Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg? Oder, anders gefragt: Belebt Konkurrenz wirklich immer das Geschäft?
Zunächst gilt es, die Variablen „Organisationskultur“ und „Unternehmenserfolg“ genauer zu bestimmen. Edgar Schein, Professor emeritus für Organisationspsychologie und Management am Massachusetts Institute of Technology (MIT), definiert Organisationskultur als ein „Muster gemeinsamer Grundprämissen, das die Gruppe bei der Bewältigung ihrer Probleme externer Anpassung und interner Integration erlernt hat, das sich bewährt hat und somit als bindend gilt; und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter Ansatz für den Umgang mit Problemen weitergegeben wird“ (Schein, 1985). Dabei spielen laut Schein die Ebenen der unsichtbaren Grundannahmen, der teilweise sichtbaren Normen und der sichtbaren, aber interpretationsbedürftigen Artefakte einer Organisation zusammen.
Im Hinblick auf den Unternehmenserfolg ziehen John Kotter und James Heskett in ihrer umfangreichen Studie Corporate Culture and Performance (1992) drei Messgrößen heran: Umsatz, Aktienkurs und Reingewinn. Die beiden Harvard-Professoren analysierten hierfür die Entwicklung von mehr als 200 US-amerikanischen Großunternehmen in 22 verschiedenen Branchen über einen Zeitraum von 11 Jahren. Die untersuchten Organisationen ließen sich dabei deutlich einem von zwei kulturellen Archetypen zuordnen: einer „unterstützenden / befördernden“ oder einer „nicht unterstützenden / nicht befördernden“ Organisationskultur.
Die Autoren James Tamm und Ronald Luyet (2004) sprechen in diesem Zusammenhang von „Green Zone“- und „Red Zone“-Organisationen. „Grüne“ Organisationen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Vertrauen, Ehrlichkeit, Zusammenarbeit, Motivation sowie eine geteilte Vision aus. „Rote“ Organisationen sind hingegen eher von Schuldzuweisungen, Angst, Zynismus, Feindseligkeiten und Verantwortungsdiffusion geprägt. Wettbewerb gibt es in beiden Organisationsformen, jedoch wird er im grünen Modell konstruktiv ausgetragen, während er in roten Organisationen als „Hyperrivalität“ gelebt wird.
Die Ergebnisse von Kotter und Heskett (1992) lassen aufhorchen. Im Betrachtungszeitraum stieg der Umsatz bei „Grünen“ Unternehmen um 682%, bei „Roten“ hingegen nur um 166%. Die Aktienkurse der „Grünen“ Unternehmen kletterten im selben Zeitraum um 901%, bei „Roten“ Unternehmen nahmen sie lediglich um 74% zu. Die deutlichste Diskrepanz zeigt sich beim Reingewinn. Dieser lag bei „Grünen“ Unternehmen am Ende der Untersuchung um 756% höher als zu Beginn, bei „Roten“ Unternehmen stieg er hingegen nur um einen Prozentpunkt.
Neuere Studien untermauern diese Ergebnisse und zeigen zudem auf, wie „ungesunde“ Kulturen auch über das Finanzielle hinaus eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung erschweren. Für ihre Untersuchung Corporate Culture: Evidence from the Field (2017) befragten John Graham, Campbell Harvey, Jillian Popadak und Shivaram Rajgopal weltweit 1.800 CEOs und CFOs zur Bedeutung der Kultur in ihren Organisationen. Die vier Forscher der Duke University und der Columbia University ermittelten, dass 79% aller befragten UnternehmenslenkerInnen die Kultur zu den fünf wichtigsten Werttreibern ihrer Firmen zählen. Stichpunkt Wettbewerb: 54% der TopmanagerInnen würden vom Kauf eines anderen Unternehmens absehen, wenn zwischen Mutter und Tochter keine kulturelle Passung herrschte. Ganze 85% der CEOs und CFOs glauben, dass eine ineffektive Kultur das Risiko für unethisches oder gar illegales Verhalten der Angestellten erhöht (Graham, Harvey, Popadak, & Rajgopal, 2017).
Ist die Kultur nun also der ultimative Stellhebel, um das Unternehmensergebnis zu verbessern und ein gesundes, lösungsorientiertes Konkurrenzdenken in Organisationen zu etablieren? Hierzu gibt es zumindest eine wichtige Einschränkung. Clayton Christensen, Professor an der Harvard Business School, weist auf das Phänomen der „kulturellen Rigidität“ (2006) hin. Dieses wirkt sich vereinfacht gesagt wie folgt aus:
1. In einer Organisation bilden sich auf Basis der (Vor-)Erfahrungen der Mitglieder bestimmte Herangehensweisen in der Lösung von Problemen heraus.
2. Diese Musterlösungen werden als best practices weitergegeben und entwickeln sich im Erfolgsfall zu einer immer unbewussteren, flächendeckend getragenen Organisationskultur.
3. Diese Kultur macht die Organisation eine Weile (mäßig bis außerordentlich) erfolgreich.
4. Dann setzt das Phänomen der kulturellen Rigidität ein: Tradierte, bewährte Grundannahmen, Normen und Artefakte werden nicht mehr ausreichend hinterfragt oder weiterentwickelt, so dass Veränderungen „verschlafen“ werden.
5. Die Kultur, die die Organisation lange stark machte, wird ihr aufgrund ausbleibender kultureller Innovationen zum Verhängnis – im schlimmsten Fall droht das Zerbrechen der Organisation.
Zusammenfassend wird deutlich: Eine starke, auf konstruktive Zusammenarbeit und gesunden Wettbewerb ausgerichtete Kultur ist für Unternehmen ein echtes Faustpfand. Sie macht Organisationen in Bezug auf wichtige finanzielle Kennzahlen um ein Vielfaches erfolgreicher als eine eher auf klassischem Konkurrenzdenken à la “Hauen und Stechen” basierende Kultur. Nichtsdestotrotz sollten sich auch Unternehmen mit einem ausgeprägten und effektiven Miteinander vor der Problematik der kulturellen Rigidität in Acht nehmen. Sonst laufen sie aufgrund der sich immer schneller verändernden Rahmenbedingungen Gefahr, in einem schleichenden Prozess das eigene Erfolgsrezept ins Gegenteil zu verkehren.
Quellen

